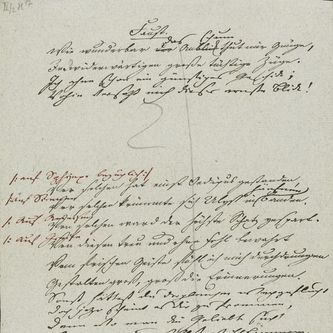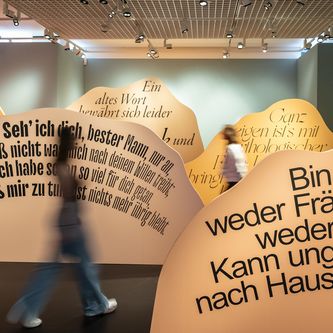Vorhaben der Klassik Stiftung Weimar werden gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und den Freistaat Thüringen, vertreten durch die Staatskanzlei Thüringen, Abteilung Kultur und Kunst.
- Angebote in der Weimar+ App
- barrierefreies WC vorhanden
- Fahrstuhl vorhanden
- Geführte Tour für Besuchergruppen mit Blindheit und Sehbeeinträchtigungen möglich
- Rollatorzugang möglich
- Rollstuhlzugang möglich
- Zugang mit elektrischem Rollstuhl möglich