Vorhaben der Klassik Stiftung Weimar werden gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und den Freistaat Thüringen, vertreten durch die Staatskanzlei Thüringen, Abteilung Kultur und Kunst.
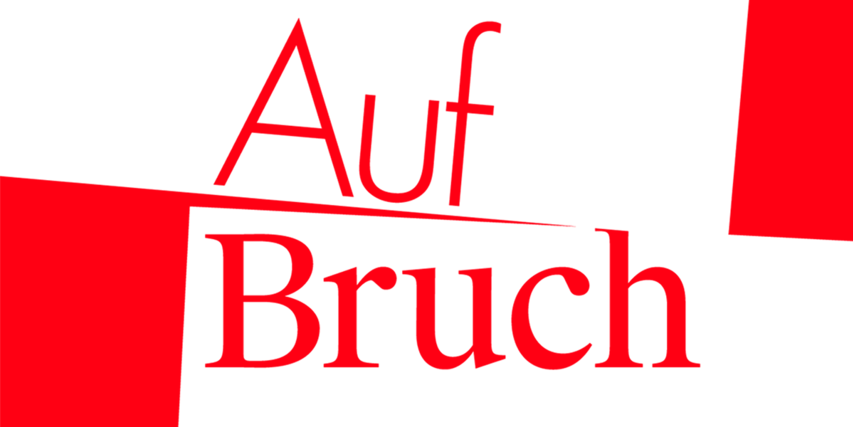
Klassik Stiftung Weimar startet in das Themenjahr „Auf/Bruch“
Zum Magazin „klassisch modern“ der Klassik Stiftung Weimar
Das komplette Programm des Themenjahres „Auf/Bruch“ finden Sie hier.
Vor dem Hintergrund des Thüringer Wahljahres 2024 widmet die Klassik Stiftung Weimar ihr Themenjahr dem 20. Jahrhundert mit seinen radikalen Auf- wie Umbrüchen. Ausgewählte Sammlungsbestände der Stiftung werden im Kontext der historischen Wendepunkte 1924, 1933 und 1949 auf ihre Überlieferungszusammenhänge untersucht und etablierte Deutungsmuster hinterfragt. Im Fokus der Ausstellungen, Veranstaltungen und diskursiven Projekte steht jeweils die zentrale Frage, welche Verbindung Kultur und Politik immer wieder aufs Neue eingehen und welche Rolle Künstler*innen und Kunst in einer liberalen und weltoffenen Gesellschaft einnehmen können. Die Jahresausstellung der Stiftung setzt sich erstmals öffentlich mit dem Thema „Bauhaus und Nationalsozialismus” auseinander. Die dreiteilige Schau verdeutlicht die komplexe politische Geschichte des Bauhauses bis zu seiner Schließung 1933 und zeigt die äußerst unterschiedlichen Lebenswege der Bauhäusler*innen in der Diktatur. Dabei wird schnell klar, dass die Moderne niemals immun war gegenüber einer Verführbarkeit durch totalitäre Regime.
Zum Auftakt des Themenjahres lädt die Tagung „Aufbrüche und Scheitern – gestern und heute“ vom 22. bis 23. März zur öffentlichen Debatte der Kernthemen des Jahres ins Studienzentrum der Herzogin Anna Amalia Bibliothek ein.
„Im Superwahljahr 2024 – 100 Jahre nach dem Rechtsruck in der Thüringer Landesregierung 1924, der zur Vertreibung des Staatlichen Bauhauses führte – wendet sich die Klassik Stiftung Weimar bewusst den existentiellen Widersprüchen des 20. Jahrhunderts zu, die unsere Gegenwart prägen. Mit dem Themenjahr ‚Auf/Bruch‘ beleuchten wir den Kampf um die Demokratie durch exemplarische Ereignisse, Persönlichkeiten und Kunstwerke. Wir fragen in Ausstellungen, Debatten, Bildungsangeboten und unserem Jahresmagazin nach der explosiven Verbindung von Kultur und Politik, Kunst und Macht – ein Thema, das gerade jetzt wieder hochbrisant wird. Damit zeigen wir als bedeutende Kultur- und Forschungsinstitution auch politisch Haltung“, so Präsidentin Ulrike Lorenz.
Auftakt Themenjahr
Nie lagen kultureller Aufbruch und Katastrophe, Scheitern und Neustart enger beieinander als in der Abfolge von Kaiserreich, Weimarer Republik, dem Zivilisationsbruch des Nationalsozialismus und der Neugründung zweier deutscher Staaten. Die Stadt Weimar ist für viele ein symbolischer Ort dieser bewegten Geschichte, deren Auswirkungen uns weiterhin beschäftigen. In einzigartiger Weise treffen hier das reiche Kulturerbe der sogenannten Weimarer Klassik und der klassischen Moderne mit den Design- und Kunstrevolutionär*innen des 20. Jahrhunderts aufeinander. Zu den Schattenseiten der Residenzstadt gehören jedoch auch antimoderne, antidemokratische und nationalistische Strömungen. Helmut Heit, Leiter des Kolleg Friedrich Nietzsche und verantwortlich für die Konzeption des Themenjahres: „Als deutscher Symbolort steht Weimar für die Idee, die Welt durch Literatur, Kunst und Kultur besser zu machen. Zugleich zeigt uns die Geschichte vor allem des 20. Jahrhunderts, wie diese Idee immer wieder schmerzhaft an der Realität gescheitert ist. Das gilt für die Avantgarde um das Nietzsche-Archiv ebenso wie für die Bauhaus-Bewegung oder den Versuch, mit Goethe in der DDR das bessere Deutschland aufzubauen. Aufbruch und Scheitern liegen in Weimar so dicht beieinander, dass man fragen muss, ob vielleicht etwas mit der Idee nicht stimmt. In der Ausstellung zu ‚Bauhaus und Nationalsozialismus‘ gehen wir dieser dramatischen Geschichte nach. In den Weimarer Kontroversen fragen wir, wie es heute mit dem Aufbruch in die Demokratie weitergehen kann.“
Zentrale Ausstellung im Themenjahr – gemeinsame Eröffnung Quartier der Moderne
Die Jahresausstellung „Bauhaus und Nationalsozialismus“ vom 9. Mai bis zum 15. September untersucht erstmals die Verstrickungen des Staatlichen Bauhauses und seiner Angehörigen mit dem Nationalsozialismus nach 1933. An den drei Orten Bauhaus-Museum Weimar, Museum Neues Weimar und Schiller-Museum zeigt die Schau auf 1.000 Quadratmetern rund 450 Kunst- und Designobjekte aus Privatsammlungen und renommierten Museen in Europa und den USA.
Über viele Jahre galt das „gute“ Bauhaus als Gegenentwurf zum Nationalsozialismus – eine zu einseitige Deutung dieser Zeit. Studierende und Dozierende des Bauhauses finden sich während des Nationalsozialismus unter den Verfolgten wie auch unter den Profiteuren des Regimes. Das Museum Neues Weimar beleuchtet unter dem Titel „Politische Kämpfe um das Bauhaus 1919−1933” die künstlerischen und politischen Konflikte, die bereits mit der Gründung der Designschule in Weimar begannen und sich in Dessau und Berlin fortsetzten. Im Bauhaus-Museum Weimar geht es unter der Überschrift „Abgehängt – Beschlagnahmt – Angepasst 1930/1937” um die Beschlagnahmung der „entarteten Kunst“ 1937 und um ihre Vorläuferaktion in Weimar. Das Schiller-Museum widmet sich schließlich den Bauhaus-Mitgliedern und ihren „Lebenswegen in der Diktatur 1933−1945”. Thematisiert werden die Gratwanderungen, die sie angesichts der neuen politischen Verhältnisse nach 1933 vollzogen.
Die Ausstellung wird im Rahmen eines Festakts am 8. Mai 2024gemeinsam mit dem Museum Zwangsarbeit im Nationalsozialismus der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora eröffnet.
Begleitende Formate in allen Institutionen der KSW
Nietzsche-Archiv
Der Schwerpunkt „Weimar und der Nationalsozialismus“ wird vom 21. März bis zum 1. November durch ein Angebot im Nietzsche-Archiv ergänzt: Was hat Friedrich Nietzsche mit dem Nationalsozialismus zu tun? Warum konnten sich Faschisten und Antifaschisten zugleich für ihn begeistern? Die Kabinettausstellung „Nietzsche im Nationalsozialismus“legt dar, wie aus einem europäischen Denker ein „deutscher Prophet“ wurde. Die Präsentation stellt die widersprüchlichen Nietzsche-Aneignungen vor und fragt nach der Verantwortung des berühmten Philosophen für diesen fatalen Bruch in seiner Wirkungsgeschichte.
Studienzentrum der Herzogin Anna Amalia Bibliothek
Den Spuren einer an Auf- und Umbrüchen dramatisch reichen Zeit widmet sich die Präsentation„Monarchisten, Demokraten, Nationalsozialisten“ im Studienzentrum der Herzogin Anna Amalia Bibliothek. Im Fokus der Schau stehen vom 23. Mai bis zum 30. November handschriftliche Widmungen aus der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts, deren Verfasser und Empfänger aus den unterschiedlichsten politischen Lagern stammten.
Schloss Belvedere und Liszt-Haus
Eine zeitgenössische Auseinandersetzung mit der bewegten deutschen Geschichte bietet die mehrteilige Ausstellung „Olaf Metzel: Deutschstunde“. An den historischen Orten Schloss Belvedere und Liszt-Haus gehen die politischen Werke des in Berlin geborenen Bildhauers und Objektkünstlers Metzel in einen inhaltlichen und ästhetischen Dialog mit der historischen Umgebung. Die Schau bildet vom 7. Juni bis 1. November den Auftakt der neuen Reihe „Weimar Contemporary“, mit der die Stiftung ihre Aktivitäten im Bereich der zeitgenössischen Kunst bündelt. Neben eigens für Weimar entstehenden Arbeiten sowie einer neuen Version von „NSU“ (2013/24) werden Installationen zum Aufeinandertreffen von Orient und Okzident wie „Kebap Monument“ (2007) oder „Turkish Delight“ (2006) zu sehen sein.
Parkhöhle
Als spezifisch naturwissenschaftlich ausgerichteter Ausstellungsort der Klassik Stiftung Weimar öffnet das „Erlebnis Parkhöhle – Durch Zeit und Klima“ ab dem 21. März im Park an der Ilm wieder für Besucher*innen. Im Zentrum der Dauerausstellung stehen die umweltbedingten großen Umbrüche vergangener und heutiger Tage: die Eiszeiten und der Klimawandel. Durch die verstärkte Einbeziehung der jüngeren Geschichte der einst künstlich angelegten Höhle setzt die neue Präsentation auch politisch-zeitgeschichtliche Akzente. Thematisiert wird unter anderem der Ausbau als Luftleitzentrale und Schutzraum im Zweiten Weltkrieg durch den Einsatz von Zwangsarbeiter*innen.
Weitere Höhepunkte 2024
Zwei Archivinstitutionen damals und heute: Vom Geburtstagsjubiläum der Archivgründerin Sophie bis zum Gedenken an den Brand der Herzogin Anna Amalia Bibliothek
Goethe- und Schiller-Archiv
Die Klassik Stiftung Weimar würdigt mit dem aktuellen Themenjahr zudem zwei besondere Persönlichkeiten, deren Beitrag zur kulturpolitischen und kunsthistorischen Entwicklung Weimars von kaum zu überschätzenden Wert ist: Die Sonderausstellung „Sophie. Macht. Literatur. Eine Regentin erbt Goethe“ setzt sich vom 8. April bis 15. Dezember 2024 im Goethe- und Schiller-Archiv kritisch mit dem Wirken der Großherzogin Sophie von Sachsen-Weimar-Eisenach auseinander. Passend zum 200. Geburtstagsjubiläum wird nachvollzogen, wie sich die gebürtige Niederländerin mit der Initiierung der ersten Gesamtausgabe von Goethes Werken und der Gründung des ersten forschungsbasierten Literaturarchivs Deutschlands unwiederbringlich in die deutsche Kulturgeschichte einschrieb.
Herzogin Anna Amalia Bibliothek
Am 2. September jährt sich der Brand der Herzogin Anna Amalia Bibliothek zum zwanzigsten Mal. Aus diesem Anlass initiierte die Bibliothek bereits im vergangenen Jahr das Projekt „Future Memory“. Zeitzeug*innen sind dazu aufgerufen, ihre Erinnerungen, Fundstücke oder Fotografien sowie ihre Erwartungen und Wünsche im Zusammenhang mit der Bibliothek zu teilen. Diese Beiträge dienen dazu, die Sammlungen der Bibliothek gemeinsam zu gestalten und somit die Grundlage für eine Bibliothek als Wissensspeicher der Zukunft zu schaffen. Die Ergebnisse werden in die Sammlungen der Herzogin Anna Amalia Bibliothek aufgenommen und ab dem 2. September veröffentlicht.
Abschluss des Jubiläumsjahres zu Caspar David Friedrich: Caspar David Friedrich, Goethe und die Romantik in Weimar
Schiller-Museum
Verkörpert die ehemalige Regentin bis heute den Aufbruch in die deutsche Kulturnation, so markieren die Werke Caspar David Friedrichs den Umbruch in die Epoche der Romantik. Als abschließendes Highlight des großen Jubiläumsjahres rund um den 250. Geburtstag des international bedeutsamen Künstlers zeigt die Stiftung vom 22. November 2024 bis zum 2. März 2025 die Sonderausstellung „Caspar David Friedrich, Goethe und die Romantik in Weimar“ im Schiller-Museum. Erstmals wird dazu der gesamte Weimarer Friedrich-Bestand an Gemälden, Zeichnungen und Druckgrafiken der Öffentlichkeit präsentiert. Der Fokus der Schau liegt dabei vor allem auf dem Karrierebeginn Friedrichs und dessen ambivalenter Beziehung zu Johann Wolfgang von Goethe.
Die Klassik Stiftung Weimar dankt ihren Zuwendungsgebern, großzügigen Förderern und Sponsoren und besonders den acht Freundeskreisen für ihr leidenschaftliches, bürgerschaftliches Engagement.
Jochen Staschewski, Geschäftsführer von LOTTO Thüringen, begründet seine wiederholte Unterstützung des stiftungseigenen Themenjahres: „Für LOTTO Thüringen als Hauptsponsor ist dieses Themenjahr von ganz besonderer Bedeutung. Damit die Thüringer Staatslotterie ihren Auftrag, das Gemeinwohl zu fördern, erfüllen kann, bedarf es stabiler demokratischer Strukturen. Deshalb ist es gerade heute so wichtig, Ursachen für Brüche in der Vergangenheit zu analysieren und daraus Lehren für die Gegenwart und Zukunft zu ziehen.“

