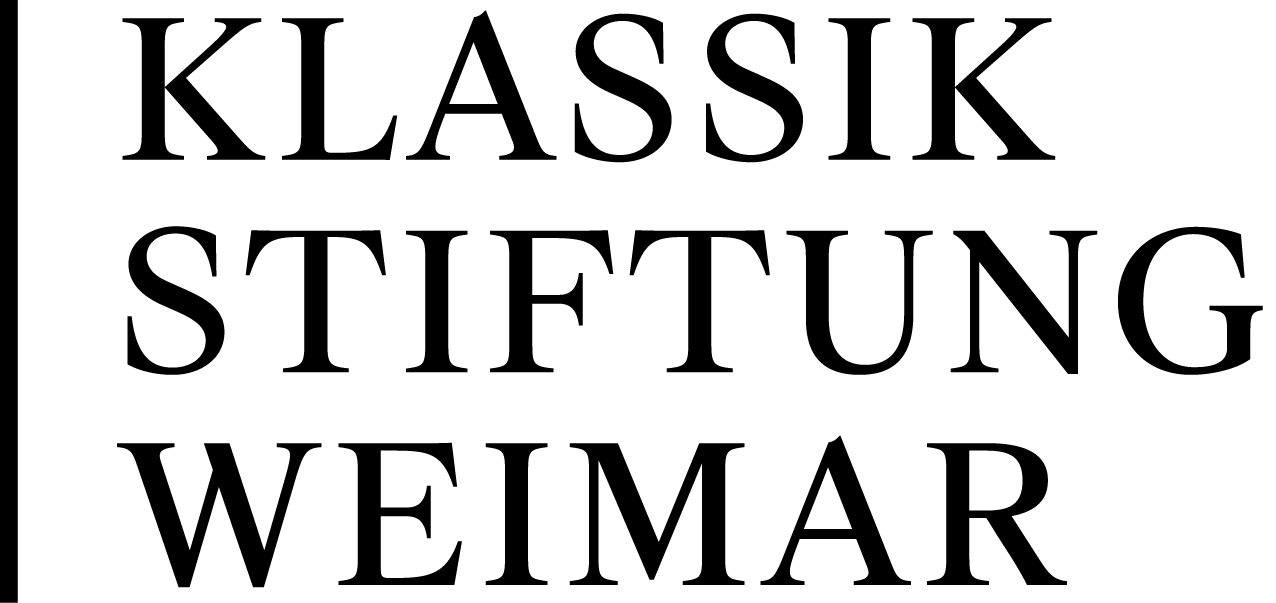Vorhaben der Klassik Stiftung Weimar werden gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und den Freistaat Thüringen, vertreten durch die Staatskanzlei Thüringen, Abteilung Kultur und Kunst.

Quartier der Moderne. Vermittlung ambivalenter Topographien
Interdisziplinäre Tagung vom 3.-5. Juli 2022
Fast alle öffentlichen Räume setzen sich aus verschiedenen Zeitschichten zusammen: In den Entstehungskontexten der Gebäude, in der Raumordnung und der Nutzung entstehen Spannungsfelder. Solchen „Ambivalenten Topographien“ widmeten die Klassik Stiftung Weimar, die Bundeszentrale für politische Bildung, die Europäische Jugendbildungs- und Begegnungsstätte Weimar, die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora und die Stiftung Ettersberg vom 3. bis zum 5. Juli 2022 eine eigene Tagung. Weimar eignet sich mit seinem „Quartier der Moderne“ wie kaum eine andere deutsche Stadt dafür, die inneren Spannungen eines öffentlichen Raumes zu diskutieren, weil hier auf engstem Raum Großbauten aus fünf politischen Systemen zusammen- und gegeneinanderstehen: Fürstenbauten, Aufbruch der Weimarer Republik, Repräsentation des Nationalsozialismus, sozialistischer DDR-Bau und bundesrepublikanische Postmoderne finden sich jeweils in Fußnähe zueinander. Die Tagung brachte Akteur*innen aus historisch-politischer Bildung, Kunst, Kultur und Architektur zusammen, die an diesem Themenbereich praktisch arbeiten.

Dr. Alexander Schmidt gab zum Auftakt in der ersten Keynote einen Einblick in seine Arbeit im Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände Nürnberg. Er begreift diesen öffentlichen Raum als Palimpsest, als Manuskript, das immer wieder überschrieben und neu arrangiert wird, aber seinen ursprünglichen Charakter nicht völlig abstreifen kann. Die Veränderungen des Reichsparteitagsgeländes begannen noch im Krieg mit der ikonischen Sprengung des Hakenkreuzes auf der Haupttribüne durch die Alliierten. Seitdem haben Um- und Neunutzungen sowie der fortschreitende Verfall die Topografie des Geländes stark verändert, das wegen seiner Dimensionen und Zentrumsnähe immer wieder Begehrlichkeiten weckt: aktuell wird über die Errichtung eines Operninterims im Innenhof der Kongresshalle diskutiert. Schmidt schloss mit einem Plädoyer für die Ambivalenz: Eindeutige Topografien seien nicht menschlich, wer ausschließlich den historisch vorgegebenen Wegen folge, sei geneigt, daraus eindeutige und unverrückbare Botschaften abzuleiten.
Die Schilderung dieser Debatte leitete über zu den „Erkundungen“ genannten thematischen Stadtführungen durch Weimar, die genau dieses Spannungsfeld beleuchteten: In von Menschen geschaffenen Topografien bilden sich über Jahrhunderte neue Bedürfnisse, Wünsche und Anforderungen an den Raum, die gezwungenermaßen in Konflikt zum durch historische Bebauung genutzten Platz stehen. So führte der Umbau des Hauptstaatsarchives Weimar im ehemaligen Marstall dazu, dass die in den dortigen Innenhof gesetzten Gestapo-Baracken in den 1990er Jahren abgerissen werden mussten, als „zermahlene Geschichte“ aber später wieder in Umrissen sichtbar gemacht wurden. Solche sichtbaren und unsichtbar gemachten Konflikte finden sich im gesamten als „Quartier der Moderne“ bezeichneten Weimarer Stadtgebiet.

Die Stadtführungen berührten dabei verschiedene Schwerpunkte der Entstehung des gegenwärtigen Weimar: Dr. Justus Ulbricht widmete sich vor allem dem Aufstieg zur „Klassikerstadt“ und der wendungsreichen Rezeptionsgeschichte des Raumes, in dem unter anderem Goethe und Schiller gewirkt hatten. Dr. Daniel Logemann hingegen fokussierte seinen Rundgang auf das Thema NS-Zwangsarbeit in Weimar, dessen Spuren an zahlreichen Orten im Stadtgebiet erfahrbar sind. Im direkten Gegensatz dazu führte Jannik Noeske an die Orte der „verschwundenen Topographie“ und damit Plätze, die nicht mehr zu sehen sind, sondern auf vielfältige Weise überschrieben wurden.
#ambivalenzverstehen
In der mit #ambivalenzverstehen betitelten Einheit wurden folgend drei Best-Practice-Ansätze zur Deutung und Erklärung räumlicher Spannungsfelder vorgestellt. Die berlinHistory App, vorgestellt von Kai Roloff, arbeitet stark kartenbasiert und bietet Texte, Bilder, Audiowalks und vieles weitere zur Geschichte der Stadt. Nutzer*innen werden in neueren Versionen der App auch zur Partizipation eingeladen, indem sie an Standorten historischer Fotos Aufnahmen der Gegenwart erstellen und hochladen können, so dass eine leicht erkennbare Gegenüberstellung der zwei Zeitebenen vorgenommen wird.
Einen künstlerischeren Weg geht das Internationale Festival für audiovisuelle Projektionen Genius Loci Weimar, das dessen Gründer Hendrik Wendler vorstellte: Künstler*innen projizieren Videokunst auf Gebäudefassaden und machen so den öffentlichen Raum zu einer Leinwand, die selbst schon durch ihre Geschichte eine Inhaltsebene hat. Als konkretes Beispiel herangezogen wurde u.a. eine zwölfminütige Projektion aus dem Jahr 2015, die Atrium und Gauforum mit einer Mischung aus abstrakter Grafik und Geschichte des nationalsozialistischen Baus bespielte.
Der Berliner Verein grenzgänge | bildung im stadtraum e.V., dessen Projekte Franziska Krüger und Franziska Langner vorstellten, versucht im Stadtraum Migrationsgeschichte zu vermitteln und zu erarbeiten. Im Projekt „Eine Ecke weiter“ erarbeiteten 15 Jugendliche aus Berlin-Lichtenberg, einem Kiez mit vielen Plattenbauten und hohem Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund, einen Audiowalk mit sieben Stationen. Darin wird die Stadt mit der individuellen Geschichte verknüpft, um von einer lokalen Ebene aus globale Migration, ihre Gründe und Auswirkungen zu erklären. Die Jugendlichen bemerkten dabei selbst eine Ambivalenz ihrer Rolle als Produzierende wie auch Konsumierende, als Analyst*innen ihres eigenen Stadtteils und der ihnen gesellschaftlich zugeschriebenen Rolle.

Das Gegenteil zum Berliner Plattenbaustadtteil stellt die Stadt Löbau am südöstlichen Rand Sachsens dar, aus der Julia Bojaryn (Stiftung Haus Schminke) das Projekt TOPOMOMO vorstellte: Das für die Architektur der Moderne architektonisch bedeutsame Haus bietet Führungen, Veranstaltungen und sogar Übernachtungen, steht aber vor dem Problem, dass es so weit abseits der Metropolen im grenznahen ländlichen Raum liegt, dass es nur wenige Gelegenheitsbesucher*innen anzieht. Aus diesem Befund entstand TOPOMOMO, ein digitaler Führer für Beispiele der Baukultur der Moderne im Dreiländereck Deutschland/Polen/Tschechien. Die Vorstellung der verschiedenen architekturhistorisch bedeutsamen Gebäude offenbart damit eine Form von spannungsgeladener Topografie, die auf den ersten gegenwärtigen Blick unsichtbar ist: einen ländlichen Raum, der vor gerade einmal 100 Jahren eine aufstrebende und prosperierende Industrieregion darstellte und wirtschaftliche, soziale und künstlerische Impulse für die ganze Welt gab.
Ein künstlerischer Impuls war auch das Wandmosaik „Die Beziehung des Menschen zu Natur und Technik“ von Josep Renau, das 1976 als architekturbezogene Kunst in Auftrag gegeben wurde, um das neugebaute Wohngebiet Erfurt-Nord aufzuwerten. Nach dem Ende der DDR verfiel es zunehmend und wurde trotz bestehenden Denkmalschutzes unzureichend gelagert, so dass es drohte, irreparabel geschädigt zu werden.
Erst ab 2015 gelang durch die gemeinnützige Wüstenrot Stiftung eine strukturierte Restaurierung und Rekonstruktion des sieben Meter hohen und 30 Meter breiten Mosaiks, das 2019 wieder am alten Standort vor einem neu gebauten Einkaufszentrum aufgestellt wurde. Das hier entstandene Spannungsfeld aus sozialistischer Kunst im marktwirtschaftlich neu geordneten Raum beschrieb der projektbeteiligte Kunsthistoriker Dr. Oliver Sukrow (TU Wien) als Form eines „Bauformzitates“ angesichts der großen Beliebtheit des Kunstwerks in seinem ursprünglichen Viertel.
Eine besondere Form eines spannungsgeladenen öffentlichen Raumes stellt auch das Dokumentationszentrum Topographie des Terrors in Berlin dar, das Ulrich Tempel vorstellte: Auf dem Gelände befanden sich zwischen 1933 und 1945 die Zentralen des Unterdrückungssystems des Nationalsozialismus. In dem Gebäude, in dem Ludwig Mies van der Rohe noch Anfang des 20. Jahrhunderts Architektur studiert hatte, saß ab den 1930er Jahren die Gestapo; im direkten Umfeld befinden sich das Berliner Abgeordnetenhaus (ehemals Preußischer Landtag), Wohnhäuser der Internationalen Bauausstellung der 1980er Jahre und 200 Meter der Berliner Mauer. An wenigen Plätzen in Berlin treffen alle maßgeblichen Epochen der Moderne der Stadt so unmittelbar aufeinander, so dass keine Führung durch das Haus ohne ausdrückliche Thematisierung des Raumes auskommt, indem sie stattfindet. Das Gesamtensemble soll künftig deutlich stärker in die
Vermittlungs- und Bildungsarbeit einbezogen werden.

Die in den Vorträgen gewonnenen Einblicke wurden im Anschluss in verschiedenen Workshops in kleineren Gruppen in neuen Zusammenhängen diskutiert. Den komplexen Umgang mit schwierigem Erbe im ländlichen Raum diskutierte Fridtjof Florian Dossin vom Institut für Graue Energie, einem Verein, der sich der Rettung von Altbestandsbauten und Brachflächen (post-)industrieller Räume widmet: Graue Energie bezeichnet dabei die Energie, die in den Materialien gespeichert, aber nicht erneuerbar ist. Um künftigen Energieaufwand durch Neubauten zu reduzieren, strebt das Institut daher die Erhaltung an, um sie als Reallabore zu verwenden, in denen der zukünftige Umgang mit solchem baulichen Erbe zu diskutiert und erprobt werden kann. In einem ersten Schritt geschieht das gerade in Oßmannstedt, einem Nachbardorf von Weimar, wo direkt an der Bahnstrecke ein 1940 errichteter Getreidespeicher seit 1990 ungenutzt verfällt. Der mittlerweile unter Denkmalschutz gestellte Bau soll nur minimal umgebaut werden, so dass er theoretisch in der Zukunft auch wieder für seinen Ursprungszweck verwendbar wäre. Als konkretes Problem sieht das noch junge Institut die Vermittlung des im Ort als Landschaftsmarke beliebten Speicherturms als Teil einer ambivalenten Geschichte: Gebaut wurde er im Zuge der Kriegsvorbereitung Nazi-Deutschlands, in den Jahrzehnten nach 1945 wurde er von der DDR-Landwirtschaft unverändert weitergenutzt.
Das vermutlich bundesweit derzeit meistdiskutierte Bauensemble betrifft das Humboldt Forum in Berlin, zu dem Dr. Judith Prokasky und Dr. Uta Kornmeier Einblicke gaben: Das Forum wird präsentiert als ein vielschichtiger Ort, der mit seinen Vorgängerbauten, dem Palast der Republik und dem Berliner Stadtschloss, sowie der angrenzenden und umgebenden Topografie kontinuierlich mit Macht assoziiert war und ist. Das Humboldt Forum versteht sich als Raum ganz unterschiedlicher Akteur*innen unter einem Dach, was gleichzeitig auch bedeutet, dass sich Kritik an Einzelaspekten oder der Gesamtkonzeption über das gesamte Bauwerk verteilt. Entsprechend kontrovers verlief auch die Debatte über die vielen polarisierenden Aspekte des gesamten Humboldt Forums, die aufzeigte, wie viele Facetten des Projektes zur Debatte einladen und wie viele Kontroversen noch zu verhandeln sind.
Sarah Fortmann-Hijazi präsentierte in ihrem Workshop Ansätze von Multiperspektivität und dem Einsatz von Museen als Begegnungsräumen: das Multaka-Projekt (nach dem arabischen Wort für Treffpunkt) lädt Geflüchtete in vier Berliner Museen dazu ein, Führungen und Workshops auf Arabisch und Persisch zu geben. Dabei geht es auch darum, die Museen zu dekolonisieren und mit neuen Perspektiven zu kontextualisieren, sowie andere Besucher*innengruppen einzuladen. Insgesamt soll so multiperspektivische kulturelle Bildung für die Gesamtgesellschaft erreicht werden, ohne die Geflüchteten zu einem „Kunstprojekt“ zu machen. Im Verlauf des Workshops wurde deutlich, dass auch Exponate Teil ambivalenter Topografie sind und in der Vermittlungsarbeit hochgradiger Besucher*innenorientierung bedürfen. So wie die Räume je nach Vorprägung unterschiedlich aufgefasst, emotional rezipiert und verstanden werden, müssen auch verschiedene
Erfahrungsräume zugelassen werden, um ein vielfältiges Museumserlebnis zu ermöglichen.



#ambivalenzsichtbarmachen
In der Einheit #ambivalenzsichtbarmachen wurden weitere Projekte vorgestellt, die sich nicht nur der Vermittlung, sondern auch der Erkenntnis von Spannungsverhältnissen widmeten: Das Projekt Connecting Spaces des Hauses der Geschichte Baden-Württemberg wurde von Dr. Caroline Gritschke vorgestellt. Hier beschäftigten sich Jugendliche aus Reutlingen und Prizren im Kosovo mit ihrer Perspektive auf ihre Stadt und ihrem Leben im öffentlichen Raum, mit teils überraschenden Erkenntnissen: Die Reutlinger Jugendlichen waren sich unsicher, ob sie die wohlhabendsten Stadtteile überhaupt betreten durften, während die Teilnehmer*innen aus Prizren sich gleich größtenteils in den Stadtrand und ländlichen Raum orientierten, weil es urban keine für sie designierten Plätze gibt. Im Laufe des Projektes änderte sich der Fokus dann weg von der geteilten Erfahrung zwischen den Bewohner*innen beider Städte hin zu einem individualbiografischen Zugang der Verbundenheit mit bestimmten Orten im urbanen Raum, inszeniert über Instagram, Musik oder Acrylmalerei. Die Ergebnisse wurden schließlich als Intervention im Ausstellungsbereich „Städtelandschaft. Urbanität und Kultur“ des Hauses der Geschichte Baden-Württemberg gezeigt.
Einen ebenfalls künstlerischen Weg, mit Raum als historischer Konstante umzugehen, stellte Dorothee Janssen vor, die für den Verein CultureClouds e.V. das Projekt „Always remember. Never forget“ präsentierte, das in Zusammenarbeit mit dem NS-Dokumentationszentrum München entstanden ist. In diesem Projekt erforschten Jugendliche die Geschichte des ehemaligen NS-Judenlagers Milbertshofen in München, von dem aus die erste Deportation Münchner Jüdinnen und Juden erfolgte. Durch Recherche, Zeitzeug*innengespräche, Diskussion, aber besonders auch Tanz und Performance erarbeitete die Gruppe ein Konzept für den öffentlichen Raum und zeichnete die Umrisse einer Kinderbaracke maßstabsgetreu am ehemaligen Standort ein.
Das Sichtbarmachen von Ambivalenzen im öffentlichen Raum war auch Inhalt der drei darauffolgenden Workshops. Bernd Kugler und Frederike Lange vom Kopfball Lernzentrum des Fanprojekts des 1. FC Nürnberg demonstrierten die Möglichkeiten von Bildungsarbeit im Kontext der organisierten und aktiven Fanszene eines großen Profifußballvereins: Diese Aufgabe trifft dort auf etablierte Strukturen, die sich zwar oft dezidiert antirassistisch positionieren, aber auch inneren Abläufen und Gesetzmäßigkeiten einer nach außen abgeschirmten Fanszene folgen, die nicht immer auf den ersten Blick nachvollziehbar scheinen. So gibt es beim 1. FC Nürnberg rechtsextreme Fans, die sich dem Freund*innen- und Unterstützer*innenkreis der rechtsterroristischen Gruppe NSU zuordnen lassen, von anderen, eher linken Fanorganisationen aber geduldet werden, solange sie sich im Stadion nicht dezidiert politisch äußern. In der Workshoparbeit zum Stadtrundgang zum Gedenken an die NSU-Opfer kristallisierte sich heraus, dass auch unter den Fachteilnehmer*innen mehr Wissen über die Täter*innen des NSU und die Rolle der Sicherheitsbehörden vorhanden war als über die Opfer, ihre Angehörigen und deren Bemühen um Gehör. Der Rundgang im Nürnberger Stadtraum zielt darauf ab, diese Wissenslücken zu füllen und auch im ambivalenten Fanraum Stadion
nachhaltige Aufklärungsarbeit zu leisten.

Über Monster einer imperialen Lebensweise informierte Dr. Oliver Emde (Universität Hildesheim/Die Kopiloten e.V.): So bezeichnet der Audiowalk die Aspekte der Lebensrealität westlicher Gesellschaften, die, ob bewusst oder unbewusst, auf Kosten anderer Menschen und Regionen der Welt ausgelebt werden, vor allem im Konsumbereich. Dieses Konzept des außerschulischen globalen Lernens zielt darauf ab, diese „Monster“ sichtbar zu machen, zur Reflexion anzuregen und, analog zum Prinzip der „Pokémons“, andere „Monster“ zu zeigen, die diese imperiale Lebensweise angreifen und lindern möchten. Die Teilnehmer*innen werden damit selbst zu „Monsterforschenden“ über die Folgen einer Externalisierungsökonomie und nehmen gerade den Raum der Stadt auf eine neue Weise wahr, die die konkreten Auswirkungen des globalen Ungleichgewichts sichtbar macht.




Nicole Vrenegor von der Open School 21 zeigte in ihrem Workshop, wie Lernen in der Stadt möglich ist: Welche Inhalte und Methoden für Jugendliche sind geeignet, um das Geworden-Sein von Stadt zu zeigen? Was macht einen Ort zu einem guten Lern- und Erfahrungsort? Ausgehend von bisherigen Erfahrungen aus Hamburg zeigte Nicole Vrenegor bei einem Galeriewalk in der Weimarer Altstadt, dass der Lernerfolg umso höher ist, je mehr Sinne angesprochen werden. Lesen, Hören, Sehen oder die Aneignung durch eigenes Handeln, sogar Riechen und Schmecken lassen Verknüpfungen im menschlichen Gehirn entstehen, die ein Abspeichern und vor allem ein Abrufen der Informationen signifikant erleichtern. Dieses mehrkanalige Lernen machen sich die Multiplikator*innen der Open School 21 zu Nutze: Hier vermitteln Kunst- und Kulturschaffende, Wissenschaftler*innen, Mitarbeitende von NGOs, Journalist*innen und Unternehmer*innen aus ihrer jeweils eigenen Expertise. Priorität hat dabei, die Workshops an themenrelevanten Orten stattfinden zu lassen. Durch aktive Beteiligung der Workshop-Teilnehmenden und einer Kombination von inter-, trans- und multidisziplinären Methoden können ambivalente Orte so nicht nur sichtbar, sondern sinnlich erfahrbar gemacht werden und eine Stadterkundung mit nachhaltigem Mehrwert bieten.
#ambivalenzvermitteln
In der letzten Themeneinheit #ambivalenzvermitteln stellte zunächst die Künstlerin Anke Heelemann die Fotothek für vergessene Privatfotografien vor, ein seit 2006 laufendes Sammelprojekt. Mit diesem Fundus gerade auch von Aufnahmen des öffentlichen Raumes werden unter der Bezeichnung „Vorwärts in die Vergangenheit“ sogenannte „performative Erkundungen“ z.B. in Weimar oder Jena-Lobeda ermöglicht. Häufig werden alte Aufnahmen mit der Gegenwart kontrastiert, um einen bestimmten Zeitabschnitt oder die Entstehung des topografischen Raumes zu vermitteln. Zusätzlich wird mit Schauspieler*innen und Requisiten gearbeitet, als Beispiel wurden antisemitische Flugblätter der 1920er Jahre in einem geschützten Raum auf eine Besucher*innengruppe fallengelassen. An genau dieser Form von „Re-Enactment“ knüpfte in der Folge auch Kritik an, da sich solche Inszenierungen im Rahmen einer Stadtführung nicht ausreichend kontextualisieren ließen.
Angela Kobelt vom Kulturkosmos Leipzig stellte anschließend einen „performativen Hörspaziergang“ durch die Stadt Demmin vor, die eine Geschichte als bedeutende und wohlhabende Handelsstadt hat, heute jedoch zu den ärmsten Kommunen der Bundesrepublik gehört und hauptsächlich dadurch bekannt ist, dass es dort zum Ende des Zweiten Weltkriegs zu einer hohen Zahl von Suiziden kam. Gerade diese schwierige Geschichte und ihre Einbettung in den öffentlichen Raum der Stadt hat dazu geführt, dass viele Bürger*innen gegenüber externen Kulturschaffenden hochgradig misstrauisch sind. Hier galt es in einem ersten Schritt Vorbehalte abzubauen und dann den Audiowalk in enger Zusammenarbeit mit Kräften vor Ort zu erstellen: Ambivalenz im Stadtraum ergibt sich auch durch die kollektive Erfahrung der Einwohner*innen.



Abschließend brachte der Stadtsoziologe Prof. Dr. Frank Eckardt (Bauhaus-Universität Weimar) einige liebgewonnene Ansichten zum öffentlichen Raum Stadt zum Wanken: Die schöne, seit dem Mittelalter prävalente Vorstellung, dass der öffentliche Raum dazu diene, dass sich Menschen dort treffen, kennenlernen und eine städtische Gemeinschaft bilden, sei von der Empirie nicht gedeckt. Die meisten Menschen beträten den öffentlichen Raum, um dort mit Menschen zu interagieren, die sie ohnehin schon kennen, zumindest aber Menschen, von denen sie vorab wissen, dass sie gemeinsame soziale Interessen, Vorlieben oder Strukturen teilten: Dadurch entstehe eine parochiale Soziabilität, aber keine schrankenlose Kommunikation mit sämtlichen anderen sozialen Gruppen desselben Raumes. Durch diese sich volatil verändernden sozialen Gruppen entstünden aber auch exkludierende Faktoren: Einerseits gebe es eine marktwirtschaftlich überformte Entwicklung des öffentlichen Raumes, die beispielsweise Aufenthalte ohne örtlichen Konsum unattraktiv mache, um die örtliche Gastronomie zu stützen, und die wahrnehmbare Anwesenheit von obdachlosen Menschen verunmögliche: Der Fokus auf Sicherheit und Profitabilität habe dabei jenen, die diesen Zielen tatsächlich oder vermeintlich entgegenstünden den öffentlichen Raum entzogen. Eine solche exklusionistische Raumbesetzung geschehe aber auch mit bestem Willen etwa durch öffentliche Hochkultur, die als Barriere für Menschen fungiert, die mit solchen Inszenierungen nichts anzufangen wüssten. Der öffentliche Raum als voraussetzungsloses Verfügungsmoment für alle sei daher auf dem stetigen Rückzug.
Zuletzt boten die Kunsthistorikerin Dr. Andrea Bärnreuther und die Architektin Carina Kitzenmaier von Taking a Stand Berlin einen Themenimpuls in Form einer Vision dessen, wie das ehemalige Gauforum in Weimar in Zukunft für die Erinnerungsarbeit genutzt werden könne: Sie verstehen darunter gesamtgesellschaftliche Lernprozesse, die aus Reflexion und Handlungskompetenz zur Zukunftsgestaltung befähigen. Kitzenmaier und Bärnreuther regen dazu an, vor allem Schüler*innen einzubinden, weil diese Generation das Lernen mit Abstand am besten beherrsche. Der dafür notwendige temporäre Lernraum solle auf dem Gelände des ehemaligen NS-Aufmarschplatzes geschaffen werden in der Hoffnung, dass sich durch den so neu demokratisch besetzten Raum neue „partizipatorisch-demokratische Ansätze“ ableiten ließen.
Mit diesem Impuls entstand eine neue, doppelte Ambivalenz: Die des Raumes an sich und, auf einer Meta-Ebene der Tagung, die einer bewussten Neubespielung des ambivalenten Raumes. Nimmt man Frank Eckardts Bedenken zur Exklusion im öffentlichen Raum ernst, kann ein „demokratisches Reallabor“ am Gauforum zu einem Ausschluss nichtschulischer und nichtakademischer Menschengruppen aus genau diesem öffentlichen, eigentlich demokratischen Raum führen. Das Ergebnis könnte hochgradig kontraproduktiv wirken: Genau die Bevölkerungskohorten, die Partizipation und demokratisches Handeln mit antreiben müssen, würden sich aus dem dafür zur Verfügung gestellten Raum zurückziehen.

So endete auch die Tagung „Ambivalente Topographien“ durchaus ambivalent: Ein mehrfach vorgebrachter Kritikpunkt war die mangelnde Definition von Ambivalenz, die teils als Uneindeutigkeit, teils als Spannungsverhältnis, teils als offene Unvereinbarkeit interpretiert wurde. In einem weitgefassten Begriff allerdings zeigte sich, dass die Spannung nicht nur von den Topographien selbst kommt, sondern von den vielen Interessenlagen, die an ihnen ziehen: Konkrete Nutzbarkeit, etwa für Wirtschaft, Handel oder Wohnraum, historische Verantwortung, teils auch der reine Erhalt verfallender Bausubstanz, in zunehmendem Maße auch Nachhaltigkeit, Ressourcenmangel und Klimawandel. Selten in der Tagung war von Abriss die Rede, häufig von Kontextualisierung oder Ergänzung. Der Umgebung des Tagungsortes Weimar war es wohl geschuldet, dass dabei die Perspektive der strukturstarken Regionen weitgehend unterging: Wo Bodenfläche knapp ist, stellen sich auch an historisch gewachsene Topografien andere Fragen zu Erhalt und (Um-)Nutzung auch von schwierigem Erbe. Wo diese Perspektive vorkam, stammte sie häufig aus Berlin, das als Hauptstadt mit vielen Gedenkstätten und Bundes- und Landesbehörden eine breite demokratisch-verantwortungsvolle Sondernutzung aufzeigt. Viele andere Großstädte und Metropolregionen hingegen haben einen deutlich größeren privaten Wirtschaftssektor, der in diese Gestaltung des ambivalenten öffentlichen Raumes eingebunden werden muss. Es bleibt also viel Raum und Notwendigkeit für Gestaltung in einem der großen Zukunftsthemen im Deutschland des 21. Jahrhunderts.

Text: Moritz Hoffmann, freier Historiker
Fotos: Thomas Müller