Ganzjährig zugänglich
Allgemeine Öffnungszeiten
Ganzjährig zugänglich
„Weimar ist eigentlich ein Park, in welchem eine Stadt liegt.“
Schriftsteller Adolf Stahr, 1871
Der 48 Hektar große Park an der Ilm ist ein einzigartiger Landschaftsgarten am Rande der Weimarer Altstadt. Herzog Carl August und Johann Wolfgang Goethe verwirklichten hier ihre gartenkünstlerischen Ideen. Sie schufen ein begehbares Kunstwerk mit abwechslungsreichen Landschaftsbildern, Parkarchitekturen und Sitzgelegenheiten, das bis heute der Erholung, der Bildung und dem ästhetischen Naturgenuss dient.
Ganzjährig zugänglich
Allgemeine Öffnungszeiten
Ganzjährig zugänglich
Die Entstehung des Parks an der Ilm ist eng mit Goethes Leben und Wirken in Weimar verbunden. 1776 schenkte Herzog Carl August dem Dichter ein Haus mit Garten, heute bekannt als das im Park an der Ilm gelegene Goethe-Gartenhaus. In der Folgezeit planten Goethe und Carl August zusammen die ersten Anlagen im neuen englischen Geschmack zwischen Stadt, Schloss und Goethes Gartenhaus. So entstand ab 1778 die Gestaltung des westlichen Ilmhangs mit seinen Gehölzkulissen, Spazierwegen und Parkarchitekturen. Der 1797 fertig gestellte Bau des Römischen Hauses markiert nach der großräumigen Parkerweiterung nach Süden und der Integration älterer Schlossgärten den Höhepunkt der Parkentwicklung. Mit seinem unterirdischen Stollensystem, der Erlebnis Parkhöhle lässt sich der Park von einer ganz anderen Perspektive erkunden. Der Eingang zur zwölf Meter tiefen Höhle befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Liszt-Haus zwischen Steilhang zur Ilm und der Belvederer Allee.
Mit dem Tod Carl Augusts, der die Entwicklung der Parkgestaltung entscheidend vorangetrieben hatte, fanden die Arbeiten 1828 im Wesentlichen ihren Abschluss. In den folgenden Jahrzehnten wurde der Park zwar gepflegt, büßte jedoch durch Bebauungen in seinem Umfeld einen Teil der unmittelbaren Beziehungen zur umgebenden Landschaft ein. Zudem gefährdeten unzureichende Eingriffe in den Gehölzbestand sein ursprüngliches Erscheinungsbild. Erst mit der Übernahme des Parks durch die Nationalen Forschungs- und Gedenkstätten der klassischen deutschen Literatur (NFG) im Jahr 1970 wurden umfangreiche Wiederherstellungs-, Erhaltungs- und Pflegearbeiten an den Gehölzen, Wegen und Architekturen durchgeführt.
Die Geschichte des Parks an der Ilm (1): Die Vorgeschichte des Parks
[Musik, klingende Schwerter und Kampfgebrüll]
1547 nach dem Verlust der Kurwürde verlegten die Ernestiner ihren Stammsitz von Torgau nach Weimar. Der Herzog und seine Gemahlin bauten ab 1552 die fürstliche Residenz mit Schloss Hornstein zu einem blühenden Macht- und Kulturzentrum aus.
Der, über Brücken mit der Schlossanlage verbundene, Baumgarten des 14. Jahrhunderts wurde als Lust- und Nutzgarten umgestaltet. Der ummauerte Gartenbereich mit Sommerhäuschen, Laubhüttentischen und Bänken diente der höfischen Gesellschaft als Rückzugsort. Die Urzelle des heutigen Parks an der Ilm.
Mit den Überschwemmungen der Thüringer Sintflut am 29. Mai 1613 gingen die Gartenanlagen verloren. [Musik] Nur fünf Jahre später, im Jahr 1618, wurde auch noch Schloss Hornstein durch einen Brand zerstört. Die Planungen für einen neuen barocken Garten begannen erst nach dem Ende des dreißigjährigen Kriegs und dem Bau der Wilhelmsburg unter Herzog Wilhelm IV.
Geplant wird ein prachtvoller Kanalgarten mit Wegenetz, der teilweise gebaut wird. Der bereits 1612 oberhalb der Ilm entstandene "Welsche Garten" sollte dabei durch eine Terrassenanlage eingebunden werden. Seit 1650 steht im Zentrum des Welschen Gartens eine Kuriosität: die Schnecke, ein hölzerner Aussichtsturm bewachsen mit Linden.
Das Zusammenwachsen der Gärten zu einem großen Parkareal gelingt erst Carl August und Johann Wolfgang von Goethe 150 Jahre später mit dem Bau des Nadelöhres.
Die Geschichte des Parks an der Ilm (2): Gestaltete Natur
[Musik] Im Mai 1774 vernichtet ein weiterer verheerender Brand auch die Wilhelmsburg. Deshalb müssen neue Räume erschlossen werden und die Gärten gewinnen an Bedeutung. [Musik]
1775 wird der 18-jährige Carl August neuer Herzog des Fürstentums und holt den jungen Dichter Goethe nach Weimar. Enthusiastisch folgen beide derzeit typischen Hinwendung zur Natur.
Zwei Ereignisse führen 1778 zur Gestaltung der ersten neuen englischen Gartenpartien am westlichen Ilm-Hang, der "kalten Küche". Erschüttert durch den tragischen Freitod der jungen "Christel" von Laßberg beginnt Goethe mit der Gestaltung eines Erinnerungsortes: die Felsentreppe, später zum Nadelöhr erweitert, entsteht. Ein erster Weg von der Ilm-Auer zum Welschen Garten. [Musik]
Eine Überschwemmung verhindert ein Fest am Stern. Deshalb entsteht für den Namenstag der Herzogin Luise, nahe des Nadelöhres, das "Luisen-Kloster". Kurz darauf lässt Carl August diesen Platz umgestalten. Das neue Borkenhäuschen wird zu seinem Rückzugsort in der Natur, wo der Fürst Mensch sein konnte.
Weitere Orte entstehen in den nächsten Jahren, die bei Spaziergängern Empfindungen anregen sollen. Die Sphinx-Grotte im Stern führt in die Welt des alten Griechenlands. Der Welsche Garten mit dem gotischen Haus und der Schnecke wird zu einem Ort der Geselligkeit und der "Dessauer Stein" wird der Freundschaft zu Fürst Franz von Anhalt-Dessau gewidmet.
Goethes Epigramm "Einsamkeit" im Felsen der kalten Küche angebracht, markiert das südliche Ende des Parks. Ab 1791 wird darüber ein neuer Rückzugs Ort für Carl August entstehen: das Römische Haus. [Musik]
Die Geschichte des Parks an der Ilm (3): Ein Landschaftspark entsteht
[Musik] Ab 1780 kauft Carl August Äcker und Wiesen an, um den Park zu erweitern und zu einem Gesamtkunstwerk zusammenzuführen. So lässt Goethe am Ilm-Hang für Carl August das Römische Haus bauen: ein Landhaus nach antikem Vorbild. Der Herzog nutzt es als privaten Rückzugsort und für offizielle Anlässe. Am Haus lässt er einen Gartenbereich mit exotischen Bäumen und Pflanzen anlegen. Diese botanischen Besonderheiten erregen Begeisterung bei den Besucher*innen.
Um den Gästen ein besonderes Naturerlebnis zu bieten, werden neue Spazierwege angelegt und mit Blumenrabatten gesäumt. Aufwendig gestaltete Wege verbinden das Landhaus mit der Stadt und dem Schloss. Sie beginnen am Haus der Frau von Stein und entführen den Besucher mit Orangenbäumen, dem Ildefonso-Brunnen und der pompejanischen Bank nach Italien. Mit dem Wiederaufbau des Residenzschlosses ab 1789 verändert sich auch das Umfeld. So werden der alte Küchteich und der Floßgraben um den Sterngarten zugeschüttet. Ein Spaziergang vom Sterngarten in die Ilm-Aue ist nun möglich. Außerdem wird aus dem ehemaligen Gewächshaus nach mehrfachem Umbau der herzogliche Salon: das Tempelherrenhaus.
Nach Carl August Tod 1828 verwilderte Park ohne die notwendigen Schnittmaßnahmen. Unter dem Hofgärtner Eduard Petzold beginnen ab 1848 wieder erste Arbeiten zur Erneuerung von Sichtachsen und Pflanzenbestand. Ende des neunzehnten Jahrhunderts entdecken auch Künstler und sportbegeisterte den Park für sich.
Die Geschichte des Parks an der Ilm (4): Gartendenkmal und Erholungsraum
[Musik] Um 1900 beginnt die Stadt sich auszubreiten. Siedlungen am Horn und an der Belvedere-Allee entstehen. Durch die direkte Nähe eingeladen nutzen die Anwohner den Park als Erholungsraum. Der junge Großherzog Wilhelm Ernst lässt 1914 den Südflügel am Schloss anbauen und verschließt den direkten Zugang von der Residenz in den Park.
Auch das Ende der Monarchie, die zwei Weltkriege und die darauffolgenden Notjahre verändern den Park. Die Luftangriffe 1945 beschädigen große Teile der Pflanzungen und Wiesen. Auch das Tempelherrenhaus wird dabei zerstört. Als Folge des zweiten Weltkrieges wird am Tempelherrenhaus ab 1945 ein sowjetischer Ehrenfriedhof eingerichtet.
Um den zahlreichen Schäden und Verlusten der letzten Jahrzehnte entgegenzutreten, werden ab 1970 auch größere Maßnahmen ergriffen. Kontinuierlich erfolgen Nachpflanzungen und die Wiederherstellung von Sicht-Beziehungen. Der Park, der beispielhaft für die Entwicklung des europäischen Landschaftsparks steht, wird 1998 als Bestandteil der Welterbestätte "Klassisches Weimar" in die Welterbe-Liste der UNESCO aufgenommen.
Unsere Aufgabe liegt heute darin, ein ausgewogenes Gleichgewicht zu finden: zwischen der Erhaltung des Parks als Gartenkünstlerisches Denkmal und den heutigen Bedürfnissen der Besucher*innen. Wir laden Sie ein, mit offenen Augen, den Park an der Ilm zu erkunden und seine Geschichte zu entdecken.
Entdecken Sie besondere Orte an unserem interaktiven Parkmodell im Untergeschoss des Römischen Hauses und erleben Sie die Geschichte des Parks. Vier Videoanimation erzählen, wie Johann Wolfgang Goethe und Herzog Carl August den Park gestalteten und welche historischen Ereignisse ihn bis heute prägen. Im angrenzenden Raum nehmen die originalen Sandsteinskulpturen der Tempelherren, des Schlangensteins und der Sphinx aus dem Park direkten Bezug zur Entstehungsgeschichte und erzählen von sich.

Anhand einzelner Orte im Park und mithilfe unseres Geschichtenerzählers Fritz von Stein erhalten Sie ganz persönliche Einblicke in die Idee und Geschichte des Parks an der Ilm.
Viel Spaß erwartet Kinder und Familien besonders mit der Rucksack-Entdeckertour „Unterwegs mit Fritz von Stein“, den sie sich in der Tourist-Information ausleihen können. Auf einem zweistündigen thematischen Rundgang wird der Park in einzelnen Stationen erkundet.
Das App-Game „Rette den Park“ verspricht neben den für Kinder manchmal ermüdenden Museumsbesuchen Spannung und Spiel. Auf einer Mission wird der historisch wertvolle Park vor kleinen Teufelchen gerettet.
Sie sind eine große Gruppe? Mit den Touren „Park an der Ilm“ und „Phoenix aus der Asche“ erhalten führt Sie ein Guide durch Geschichte und Kultur des Parks. Weitere Informationen
Verschaffen Sie sich einen Überblick über die beste Picknickwiese, dem Platz für Kinder zum Toben und Tollen und wo sich das stille Örtchen verbirgt. Der Park an der Ilm liegt direkt an dem Ilmtal-Radweg und bietet sich deshalb für ein Ausflugsziel mit dem Rad an.
Klassische Audioguides waren gestern – heute können Sie mit unserem hörspielartigen Audiowalk der App Weimar+ auf Entdeckungsreise durch den Park an der Ilm gehen. Lassen Sie sich von den Erzählungen der Ilmnixe inspirieren, lauschen Sie den Klängen der Natur und erfahren Sie durch Zeitzeugenberichte mehr über die Geschichte des Parks. Jeder Ort im Park hält eine ganz eigene Hörspielüberraschung bereit. Mit Hilfe einer interaktiven Karte finden Sie sich im Park schnell zurecht und können Sichtbeziehungen nachvollziehen und mit einer "Fotospende" dokumentieren. Und ist man erst einmal von der Informationsfülle gesättigt, dann lockert das Spiel "Rette den Park" den Spaziergang auf. Zusammen mit einem Waldgeist können Besucherinnen und Besucher jeden Alters Rätsel lösen und mit Hilfe von Augmented-Reality Teufelchen aus dem Park vertreiben.
Laden Sie sich die App auf Ihr eigenes Gerät, gerne auch schon vor Ihrem Besuch. Kleiner Tipp: All unsere Einrichtungen verfügen auch vor Ort über WLAN.

Unser neues digitales Angebot beschäftigt sich mit den Blickachsen im Park an der Ilm, früher und heute. In der App Weimar+ können Sie jetzt mit einer Fotospende helfen, den Wandel der Sichten für zukünftige Forschungen zu dokumentieren.

Das Buch bietet vielfältige Informationen über die Geschichte des Parks bis heute, begleitet von zahlreichen Fotos. Ein Rundgang durch den Park ist ebenso enthalten wie Übersichtskarten und Interessantes zur Baum- und Gestaltungskunde des Parks an der llm.

2026 ist das Magazin dem Jahresthema „Öffnen" gewidmet. Jetzt kostenfrei vorbestellen und im März die neue Ausgabe in den Händen halten!
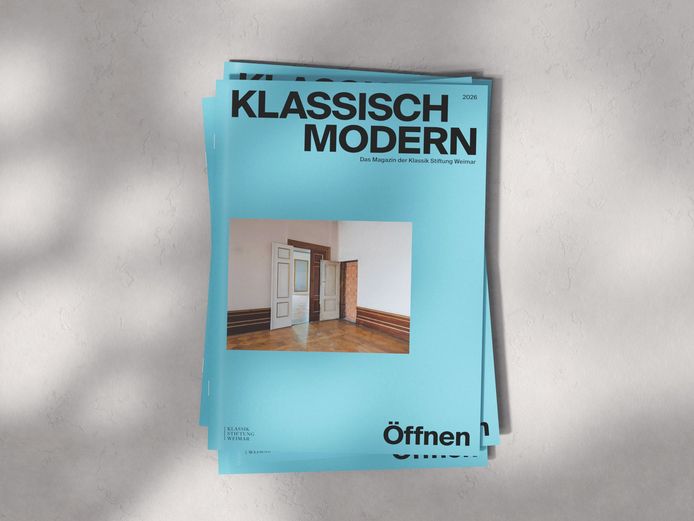
Wie hat Ihnen Ihr Besuch in Weimar gefallen? Im Rahmen einer Umfrage der Weimar GmbH und des UNESCO-Welterbestätten Deutschland e.V. möchten wir mehr über die Zufriedenheit unserer Gäste erfahren. Wir freuen uns über Ihr Feedback!