Vorhaben der Klassik Stiftung Weimar werden gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und den Freistaat Thüringen, vertreten durch die Staatskanzlei Thüringen, Abteilung Kultur und Kunst.
Ein Jahr Stiftung 2023-2024

Im Jahr 2023/24 haben neun junge Leute an der Klassik Stiftung Weimar ihr Freiwilliges Soziales Jahr absolviert. Auf dieser Webseite stellen wir euch einige Projekte vor, die die Freiwilligen in dieser Zeit eigenständig entworfen und umgesetzt haben. Auch dieses Jahr waren wieder jede Menge spannende Projektarbeiten dabei - von einer Ausstellung bis hin zu Kinder- und Kochbüchern.
Falls ihr wissen wollt, wie Ihr euch auf einen Freiwilligendienst bei der Klassik Stiftung Weimar bewerben könnt, dann guckt auf der Webseite der Freiwilligendienste Kultur und Bildung vorbei!
Zwischen Verdrängung und Erinnerung
Ella Rabeneck (Kulturelle Bildung), Elisa Bruchhäuser (Goethe- und Schiller-Archiv), Vincent Helleport (Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit und Marketing)
Für unser Projekt haben wir uns entschieden zu dritt eine Ausstellung zu entwerfen. Unsere Projektarbeit umfasste viele intensive Treffen untereinander, jede Menge Recherchearbeit, aber auch Absprachen mit unseren Teams und mit Expert*innen. Dadurch, dass wir an drei verschiedenen Einsatzstellen gearbeitet haben, hatten wir Zugang zu verschiedenen Ressourcen und haben uns so sehr gut ergänzt. Wir mussten lernen uns zu organisieren, uns zu vernetzen und waren auch viel mit Rechercheaufgaben beschäftigt. Mit dem Projekt haben wir schließlich auch den Projektwettbewerb „tatort kultur“, der jedes Jahr von der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung und der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen an Freiwillige aus Thüringen vergeben wird, gewinnen können.
Die Präsentation nahm den erinnerungspolitischen Umgang mit drei Weimarer Literaturwissenschaftlern in den Blick. Im besonderen Fokus stand dabei der langjährige Präsident der Goethe-Gesellschaft Julius Petersen und sein Wirken in der Zeit des Nationalsozialismus. Neben Petersen wurde Hans Wahl (1885-1949) als einer der einflussreichsten Germanisten Weimars und von 1928 bis zu seinem Tod 1949 Direktor des Goethe- und Schiller-Archivs thematisiert, dessen Handeln von einer Nähe zum nationalsozialistischen Regime zeugt. Julius Wahle (1861-1940) wiederum, jüdischer Literaturwissenschaftler, langjähriger Mitarbeiter und vor Wahl kommissarischer Direktor des Goethe- und Schiller-Archivs, war den Repressalien der Nationalsozialisten ausgesetzt. Alle drei prägten die Goethe-Forschung und das Archiv in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf besondere Weise. Das Projekt beleuchtete Prozesse von Anpassung und Ausgrenzung und stellte die Frage, was von ihrem Erbe bleibt.
Virtueller Rundgang
Kindergartenprojekt zu „Sophie. Macht. Literatur“
Ayleen Müller (Goethe- und Schiller-Archiv)
Es war schon zu Beginn des Jahres klar: Jahresprojekt? – Ja! Aber nur wenn das Ganze auch einem breiten Publikum zugutekommt. Da lag natürlich die Ausstellung im Goethe- und Schiller-Archiv zum 200. Geburtstag der Großherzogin Sophie sehr nahe. Eine Frau, die so viel getan hat, auch für das breite Volk, aber trotzdem häufig vergessen wird. Wenn es in Weimar nur so wimmelt von Statuen, welche Männer abbilden, ist es umso wichtiger die Frauen zu würdigen. Bildung fängt früh an. Also warum nicht versuchen Kindergruppen mit solchen Persönlichkeiten bekannt zu machen (natürlich nicht persönlich …) und Ihnen einen neuen Blick auf die Stadt Weimar zu geben? Dafür bin ich mit Kindergartengruppen durch Weimar gelaufen und habe Ihnen verschiedene Sophienorte gezeigt. Abschließend durften die Kinder Porträts von der Großherzogin malen, welche ich als eine Art Diashow für das Foyer im Goethe- und Schiller-Archiv zusammengestellt habe. Ausstellungen mit viel Text nur für ein älteres Publikum? Nicht mit mir. Ein breites Spektrum an Zielgruppen spielerisch, künstlerisch und sensibel an komplexe Themen heranführen? Na, das klingt doch nach einem Plan! Archiv heißt nicht nur viele, staubige Blätter. Wir sind auch ein Bildungsort der von unseren Besuchern, egal ob klein oder groß, lebt und wer sind wir, wenn wir diese Chance nicht nutzen?
Objekte aus dem Tiefenmagazin
Livia Klamt (Herzogin Anna Amalia Bibliothek)
In meinem Projekt stelle ich besondere Objekte aus dem Tiefenmagazin der Herzogin Anna Amalia Bibliothek vor. Ich habe eine Präsentation mit Texten und Bildern, die man per QR Code abrufen kann, erstellt. Mein Ziel ist es Gruppen aller Altersklassen einen kleinen Einblick hinter die Kulissen der Bibliothek zu geben und aufzuzeigen, was für spannende Schätze sich im Tiefenmagazin der Herzogin Anna Amalia Bibliothek befinden.
Herzogin Anna Amalia - Eine Geschichte für Kinder
Afra Kürzinger (Herzogin Anna Amalia Bibliothek)
Für mein Jahresprojekt habe ich mich von meiner Einsatzstelle inspirieren lassen. Die Herzogin Anna Amalia Bibliothek hat den Namen einer Frau angenommen, welche für Weimar eine große Rolle spielte. Die Geschichte der damaligen Herzogin wird bereits in verschiedensten Medien präsentiert und ausführlich dokumentiert. Meine Idee war es, diese Geschichte vereinfacht und trotz dessen aussagekräftig Kindern erzählen zu können. So entstand das Konzept eines Kinderbuches. In meinem Projekt habe ich die Biografie Anna Amalias gekürzt und in einfacher Sprache geschrieben. Dazu wurden bestimmte Substantive durch kleine Bilder und Motive ersetzt, sodass auch Kinder, die das lesen noch nicht gelernt haben, Teile des Textes „mitlesen“ können. Das Buch ist von Illustrationen durchzogen, welche die Geschichte visuell widerspiegeln. Hierbei können Kinder das lesen anhand einer für Weimar wichtigen Regentschaft der Herzogin erlernen.
Das Buch wurde im August und September 2024 im Kubus des Studienzentrums der Herzogin Anna Amalia Bibliothek ausgestellt und wird auch zum Ausleihen in den Bestand der Bibliothek aufgenommen, sodass jeder der will es sich ausleihen und lesen kann.
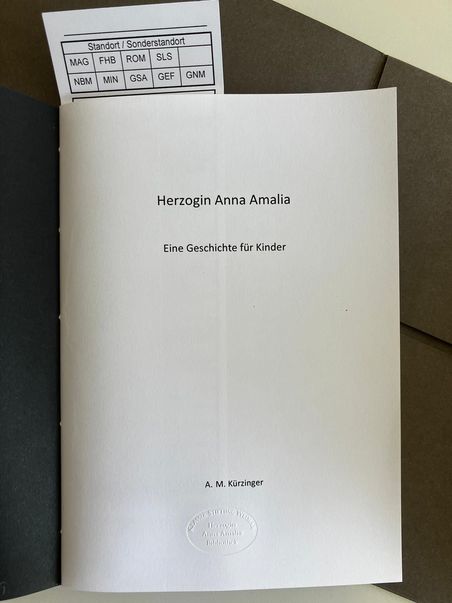
Blogartikel „Goethes Leibarzt“
Anna Gerber
Ich machte mein Frewilliges Kulturelles Jahr bis Ende Februar in der Klassik Stiftung Weimar im Bereich Forschungsarbeit und Kolleg Friedrich Nietzsche. Während dieser Zeit ergab sich für mich die Möglichkeit der Erarbeitung eines eigenen Projektes. Inspiriert durch die Nähe zu Forscher*innen aus den verschiedensten geisteswissenschaftlichen Fachgebieten und dem Erinnerungsort Johann Wolfgang von Goethes „schlechthin“, wollte ich mich gerne einem Aspekt von Goethes Leben widmen. Durch erste Recherchearbeiten stieß ich auf den Namen Christoph Wilhelm Hufelands, einem Mediziner aus der Zeit der Weimarer Klassik. Die Verbindung dieses Arztes und Naturforschers mit Johann Wolfang von Goethe wurde von nur sehr wenigen Forscher*innen untersucht. Daher stellte es ein geeignetes Thema für meinen geplanten Blogbeitrag dar.
So begann eine intensive Quellenarbeit, bei der ich mein zu untersuchendes Thema durch das Transkribieren von Primärliteratur aus dem Goethe- und Schiller-Archiv und der Verwendung von Sekundärliteratur der verschiedensten Bibliotheken wie der Herzogin Anna Amalia Bibliothek auswerten konnte.
Durch die Erstellung meines Blogbeitrages erweiterte ich nicht nur meine Fähigkeiten in Umgang mit Quellen und wissenschaftlichen Publikationen, sondern knüpfte darüber hinaus Kontakte mit Expert*innen unterschiedlichster Spezialisierung.
Den Blogartikel können Sie hier lesen.

