Vorhaben der Klassik Stiftung Weimar werden gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und den Freistaat Thüringen, vertreten durch die Staatskanzlei Thüringen, Abteilung Kultur und Kunst.
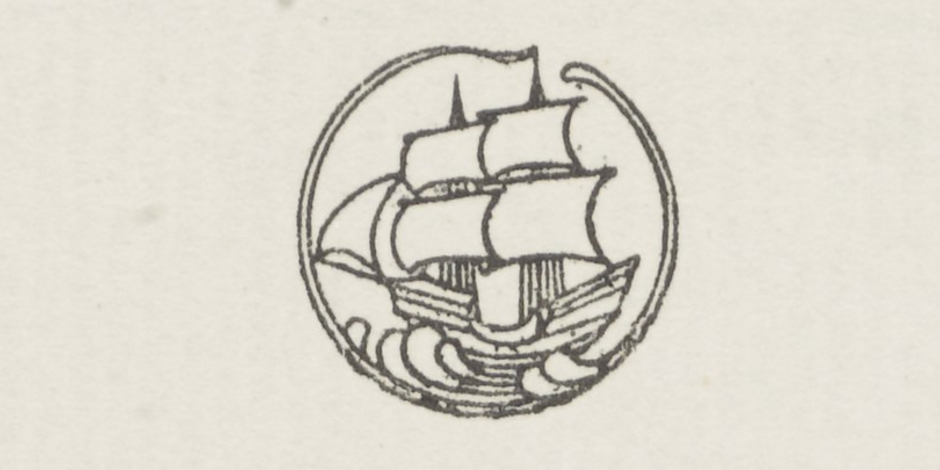
Geteilte Überlieferung.
Der Insel-Verlag im Goethe- und Schiller-Archiv Weimar und im Deutschen Literaturarchiv Marbach
Weltbibliothek 1919
„[…] denn diese Bände werden Ihnen aus den Händen gerissen werden“, schreibt Stefan Zweig euphorisch an den Verleger Anton Kippenberg. In dem Brief vom 11. Dezember 1919 fordert Zweig „Eile, Eile, Eile“ bei der Vorbereitung des Satzes und der Beschaffung des Papiers für die Bücher.
Die Rede ist von der „Bibliotheca mundi“, einer Sammlung von Werken der Weltliteratur, die gegliedert nach Nationen in den Originalsprachen erscheinen sollen. Geistiger Urheber dieser Idee ist der Schriftsteller Stefan Zweig, der als literarischer Leiter des Unternehmens die Herausgeber der einzelnen Bände bestimmt, die Reihenfolge festlegt und Korrekturen vornimmt, während dem Insel-Verlag die Herstellung und Durchführung obliegt.
Bereits 1921 erscheint die „Anthologia helevetica“, ein Jahr später die hebräische und die ungarische Anthologie. Insgesamt werden vierzehn der ursprünglich zwanzig angekündigten Bände realisiert, bis sich Herausgeber und Verleger schließlich den Misserfolg ihres Projektes eingestehen müssen und die Reihe nach Erscheinen der italienischen und französischen Anthologie 1923 einstellen.
Von den Anfängen, der Durchführung und dem vorzeitigen Ende der „Bibliotheca mundi“ erzählt der umfangreiche Briefwechsel zwischen dem Urheber und Herausgeber Stefan Zweig und dem Verleger Anton Kippenberg, der im Goethe- und Schiller-Archiv Weimar und im Deutschen Literaturarchiv Marbach bewahrt wird.
„[…] denn diese Bände werden Ihnen aus den Händen gerissen werden“
Stefan Zweig
Geteilte Überlieferung und ihre Ursprünge
Diese geteilte Überlieferungssituation geht zurück auf die komplexe Geschichte des Insel-Verlags nach 1945. Während das Stammhaus des Verlags weiterhin in Leipzig verblieb, zogen die Verleger Anton und Katharina Kippenberg von der sowjetischen in die amerikanische Besatzungszone, wo zunächst in Wiesbaden eine Zweigstelle des Verlags gegründet wurde. Dabei wurde auch ein Teil des Verlagsarchivs mitgenommen, ebenso der private Schriftwechsel des Verlegerehepaares Kippenberg. Der Wiesbadener Verlagsstandort wurde 1960 nach Frankfurt am Main verlegt und 1963 durch den von Siegfried Unseld geführten Suhrkamp-Verlag übernommen. 1991 vereinigten sich der Frankfurter und der Leipziger Insel-Verlag.
Das in Leipzig verbliebene Insel-Verlagsarchiv gelangte 1962 ins Goethe- und Schiller-Archiv. Der Bestand beinhaltet die Geschäftsakten und die Korrespondenz mit den Autorinnen und Autoren aus der Zeit von 1899 bis 1950. Einen Überblick über die Struktur sowie Möglichkeiten zur Recherche bietet die Archivdatenbank.
Das Insel-Verlagsarchiv am DLA Marbach speist sich aus verschiedenen Provenienzen. Zum einen handelt es sich um die Überlieferung der Zweigstelle Wiesbaden bzw. Frankfurt am Main aus den Jahren 1945 bis 1965. Darunter befinden sich auch Unterlagen, die bereits von Anton und Katharina Kippenberg aus Leipzig mitgenommen wurden. Die zweite Provenienz ist der Leipziger Verlagsstandort mit der Altregistratur bis 1991 und den ältesten Unterlagen von 1940. Weiterhin beherbergt das DLA Marbach das Kippenberg-Archiv mit dem privaten Schriftwechsel von Anton und Katharina Kippenberg.
Vernetzte Korrespondenzen
Auch wenn sich der erhoffte Erfolg der „Bibliotheca mundi“ nicht einstellte, sind Stefan Zweig und der Insel-Verlag noch für viele Jahre aufs engste miteinander verbunden geblieben. Zweig gehört von den 1920er Jahren an bis zum Bruch 1933 zu den erfolgreichsten Autoren des Verlags.
Mit dem gesamten Insel-Archiv ist auch der Schriftwechsel zwischen dem Verlag und Stefan Zweig geteilt überliefert. Um die Einheit des für die deutsche Literatur- und Kulturgeschichte so bedeutsamen Verlagsarchivs nach außen sichtbar zu machen, besteht zwischen dem Deutschen Literaturarchiv Marbach und dem Goethe- und Schiller-Archiv Weimar eine Kooperation über die abgestimmte Erschließung der Insel-Verlagsbestände. Auf dieser Grundlage soll die geteilte Überlieferung zumindest virtuell überwunden werden, indem die Metadaten gemeinsam präsentiert werden.
Unter die Autoren mit „geteilten“ Korrespondenzen des Insel-Verlags fallen neben Zweig zahlreiche andere bedeutende Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Philologen, Übersetzer, Buch- und Schriftkünstler der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wie beispielsweise Theodor Däubler, Ricarda Huch, Hugo von Hofmannsthal, Johannes R. Becher, Martin und Paula Buber, Rainer Maria Rilke oder Regina Ullmann. Diese Personen kommen vielfach auch in anderen Beständen des Goethe- und Schiller-Archivs vor, darunter z.B. in den Nachlässen des Schriftstellers Theodor Däubler und des langjährigen Verlagsmitarbeiters Fritz Adolf Hünich oder in der Überlieferung der Goethe-Gesellschaft, der Deutschen Schillerstiftung und des Nietzsche-Archivs in Weimar. So ergibt sich ein dichtes Netzwerk: im Goethe- und Schiller-Archiv – und weit über seine Grenzen hinaus.
Franziska Stiebritz
Das Projekt „Vertiefte Erschließung und Normierung des Bestandes Insel-Verlagsarchiv Leipzig im Goethe- und Schiller-Archiv Weimar“ wird durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft gefördert (2018–2022).
DLA-Blogbeitrag
geteilte überlieferung – globale programme. stefan zweig, die ›bibliotheca mundi‹ und das archiv des insel verlags
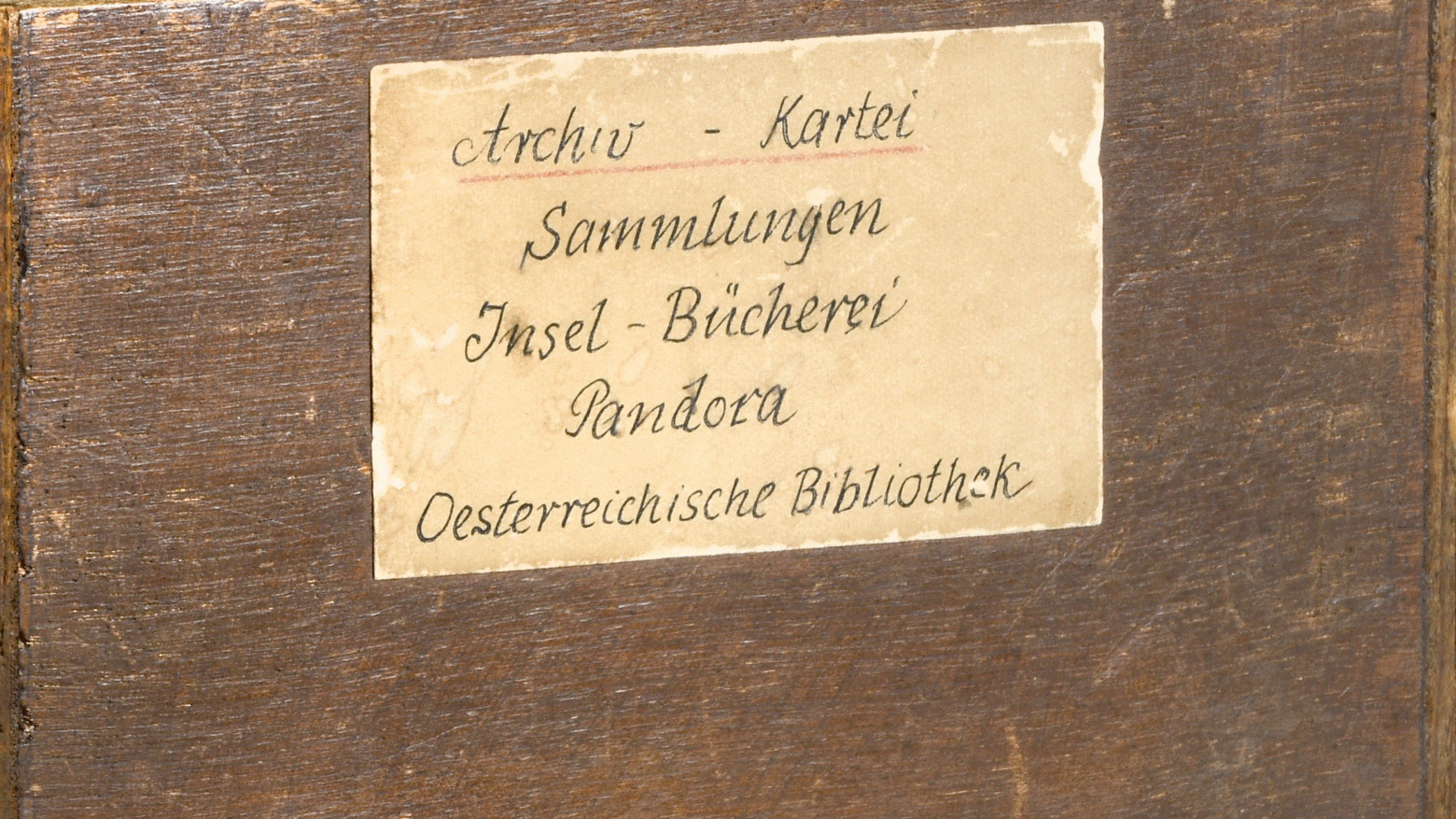
© Chris Korner, DLA Marbach

